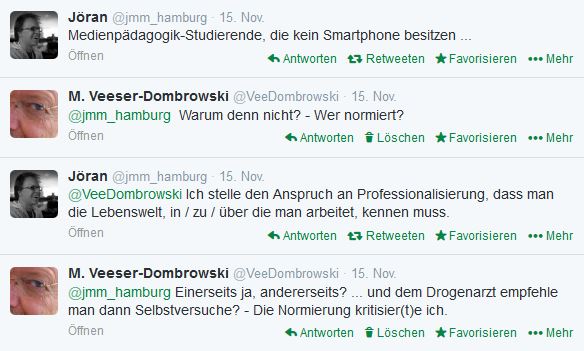Zusammenfassung
Manchmal sind Schüler*innen und Lehrkräfte geschockt und herausgefordert:
Eine Person ist verstorben, kommt nicht mehr zum Unterricht.
Wie kann man darauf angemessen reagieren?
Was hilft in so einer Situation?
Ausnahmezustand
Ob durch Unfall, Krankheit oder Selbsttötung ausgelöst, die Reaktionen sind oft Erschütterung und Herausfallen aus dem Normalzustand. Oft herrscht Sprachlosigkeit – oder aber Dauer-Reden.
Beides signalisiert den Ausnahmezustand.
Vier empfohlene Schritte
Hier beschreibe ich vier einfache und bewährte Schritte mit den betroffenen Gruppen, die ohne große methodische Vorbereitung durchführbar erscheinen.
1. Informationen sorgsam zusammentragen und Spektulatioonen verhindern
Manche Gruppen neigen zur stillen Lähmung, die anderen zum gebannten Dauergespräch.
Zum Start der Gesprächs-Runde erscheint es darum hilfreich, die vorhandenen Informationen zu sammeln. Oft wird wild spekuliert, Halbwissen lädt zur Ausschmückung ein und der Boden der Realität wird schnell verlassen. Dieser einfache Schritt der Sammlung von tatsächlich verfügbaren Informationen hilft, den Kontakt mit der Realität zu wahren.
Außerdem fällt es relativ leicht über Fakten zu sprechen, so dass auch stumm-gelähmte Personen möglicherweise wieder zu sprechen beginnen.
Als Moderator sehe ist hier meine Aufgabe darin, zum Sprechen aufzufordern, das Aussprechen-Lassen zu garantieren und immer wieder auf die Tatsachen zu achten und diese behutsam und doch deutlich von Vermutungen zu unterscheiden.
Es ist auch zu empfehlen, die Sozial-Media-Walze zu begrenzen und um eine zurückhaltende Nutzung der entsprechenden Plattformen zu bitten. Das kann auch die Trauerfamilie entlasten.
2. Reaktionen ausdrücken
Im nächsten Schritt fordere ich die Anwesenden auf, ihre ersten Reaktionen für sich selbst wahrzunehmen und dann für die anderen auszudrücken. Oft kommen dann Worte wie Überraschung, Schock, dann aber auch die Frage nach der Schuld und ob etwas getan hätte werden können, was nun leider unterlassen wurde.
Manche Personen spüren auch so etwas wie Wut.
Als Moderator sehe ist hier meine Aufgabe darin, alle Gefühle, Gedanken und Ausdrücke zu schützen:
Das wird so empfunden und darf so sein.
Außerdem mache ich deutlich, dass ich von „Schuld“ in diesem Zusammenhang nichts halte. Hier versuche ich zu entlasten.
3. Bewältigungs-Rituale anbieten
Anknüpfend an die Wut-Äußerungen frage ich im nächsten Schritt, wie sich die Zurückgebliebenen vom Abwesenden verabschieden wollen. Wenn eine Beerdigung besucht werden kann, ist dies eine Möglichkeit.
Es gibt noch andere – zum Beispiel:
- gemeinsam zu einem Gottesdienstraum zu spazieren
- einen Abschiedsbrief zu schreiben
- selbst ein Bild zu malen
- ein vorhandenes Foto heraus zu suchen
- eine Beileidskarte an die Angehörigen zu schreiben
- auch eine Sammlung kurzer Grüße an die Trauerfamilie kann passend und hilfreich sein
Als Moderator sehe ist hier meine Aufgabe darin, alle Ideen zuzulassen und die Kommentierungen weitgehend zu dämpfen: Jede und jeder darf den eigenen Weg des Abschieds für sich wählen. Oft entlasten solche Handlungen und schließen (wenigstens vorläufig) einen Trauerschritt ab.
4. Hilfsmöglichkeiten in Krisen-Zeiten sammeln
Unweigerlich stellen sich die Zurückgebliebenen die Frage, was mit Ihnen selbst ist, wenn Sie in eine Krise kommen. Besonders deutlich wird diese Frage nach einer Selbsttötung.
Hier fordere ich die Anwesenden auf, eigene Möglichkeiten des Umgangs mit krisenhaften Zuständen zu überlegen und möglichst in der Gruppe auszutauschen.
Als Moderator sehe ist hier meine Aufgabe darin, zu Hilfsangeboten zu ermutigen und konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen. So verweise ich selbst auf die Beratungslehrer/innen, Telefonseelsorge und auf psychosoziale Beratungsstellen.
Die moderierende Lehrkraft ist persönlich gefordert
Diese Situationen wünscht sich niemand. – Die eigene Betroffenheit und die Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler und der Kolleg*innen können sich überlagern. Wichtig erscheint mir, dass die moderierende Person fähig bleibt, den Prozess zu steuern.
Dazu ist es sicher hilfreich, sich schon einmal mit diesem Thema vor dem akuten Fall auseinander gesetzt zu haben:
- Welche Erfahrungen mit Leid und Tod habe ich selbst?
- Welche Einstellung zu Leid und Tod habe ich entwickelt?
- Kenne ich Hilfsangebote?
- Welche Kolleg*innen können mich in solchen Situationen unterstützen?
- Welche Material (z.B. Trauerkoffer) gibt es wo in meiner Schule?
Weiterführende Links
- Umgang mit Tod und Trauer in der Schule eine Zusammenstellung einer kirchlichen Fachstelle
- Website der Telefonseelsorge
- Schulpsychologische Beratungsstellen
- Psycho-soziale Beratungsstellen der Kommunen, hier die Psychologische Beratungsstelle aus Freiburg
- Eine Website für die Trauer von Jugendlichen mit dem sinnigen Titel allesistanders.de von der Hospitzgruppe Freiburg e.V.
- Songtext „Geborgen um zu leben“ der Gruppe Unheilig
in 2013 entwickelt, zuletzt ergänzt am 2.07.2023  zur druckerfreundlichen Ansicht
zur druckerfreundlichen Ansicht